Wer hilft Journalist:innen bei mentalen Krisen?

Ein Überblick über Hilfs- und Beratungsangebote.
Eine gerade erschienene Untersuchung zeigt, dass sich deutsche Journalist:innen mental schlechter fühlen als andere Bürger:innen. Ihr Job lässt sie häufiger unter psychosozialem Stress, Burn-out und Depressionen leiden. Die Studie nennt aber auch Auswege aus der Krise. Dazu gehören die Hilfs- und Beratungsangebote, die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Medienhäuser Kollegi:nnen in mentaler Not anbieten. Welche Anlaufstellen gibt es? Wer bekommt wie einen Zugang? Und wie helfen sie weiter? Eine Übersicht.
Peter Hagen war tief schockiert. Erstmals während seiner 40-jährigen Karriere als Lokalreporter war er direkt körperlich angegriffen worden. Der (inzwischen entlassene) Bürgermeister vom thüringischen Bad Lobenstein attackierte Hagen und zerstörte dessen Ausrüstung, als der ihn auf dem Marktplatz auf sein vertrautes Gespräch mit einem bekannten Reichsbürger ansprechen wollte.
„Man überlegt, wie sich das alles mal weiterentwickelt und ob man überhaupt in diesem Beruf noch weiterarbeiten möchte“, beschreibt der Lokalreporter der Ostthüringer Zeitung (OTZ) die tiefe Verunsicherung, die ihn nach diesem und weiteren ähnlichen Vorfällen überfiel.
Das psychische Wohlbefinden von Journalist:innen rangiert weit unter dem Durchschnitt
Anfeindungen und Übergriffe im Beruf sind nur zwei der Ursachen für psychische Stressbelastungen von Journalist:innen in Deutschland. Diesen Missstand belegt die Studie „Burning (out) for Journalism“ der Ludwig-Maximilian-Universität München (LMU) und ihres Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IfKW). Erhoben wurden die Daten in einer Online-Befragung von 1.300 Journalist:innen im Herbst 2024.
Andere Einflussfaktoren können belastende Erfahrungen bei der Berichterstattung über Kriege, Unfälle oder Naturkatastrophen sein. Aber es kann sich auch um ganz alltägliche Belastungen wie die Erwartungen von Vorgesetzten und Redaktionen, das tägliche Arbeitspensum oder die (schlechte) Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben handeln.
Als Folge rangiert das psychische Wohlbefinden von Journalist:innen deutlich unter dem des Durchschnitts der deutschen Bevölkerung. Freiberufler:innen fühlen sich dabei mental geringfügig besser aufgestellt als angestellte Journalist:innen und Männer etwas besser als Frauen.
Neben dem wenig überraschenden Befund nennt die Studie aber auch mögliche Auswege aus dem Dilemma. Das sind vor allem „organisationale Unterstützungsangebote“ und Anlaufstellen für belastete Journalist:innen. Aber auch „positives psychologisches Kapital“, das man zum Selbstschutz aufbauen kann, hilft bei berufsbedingtem Disstress.
Welche Unterstützungsangebote sind den Journalist:innen bekannt?
In der LMU-Studie wurde auch nach Angeboten zu psychologischer Beratung sowie praktischer Hilfe in psychosozialen Krisen gefragt, die den Journalist:innen bekannt sind. Dies sind vor allem die auf Unterstützung bei Hassrede spezialisierte Plattform HateAid und die Helpline von Netzwerk Recherche. Mit großem Abstand folgen das Dart Center for Journalism and Trauma, das sich in Europa wohl aus der Beratung zurückziehen muss, und die Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Tatsächlich berichteten in der Studie rund 12 Prozent der Befragten von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz, Festangestellte betrifft das Thema häufiger als Freie. Wer bei Unternehmen arbeitet, die in bestimmten Branchenverbänden, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertretungen aus der Kultur- und Medienbranche organisiert sind, oder bei Sendeanstalten, kann sich in einem solchen Fall an die Themis Anlaufstelle wenden.
HateAid: Hilfe bei digitalen Angriffen und Hassrede
Journalist:innen, die digitale Gewalt erfahren und von Hassrede betroffen sind oder Zeug:innen von Online-Angriffen wurden, finden Unterstützung und praktische Hilfe bei HateAid.
„Grundsätzlich versuchen wir immer, die Personen wieder handlungsfähig zu machen“, fasst Judith Strieder, Psychologin und Beraterin bei der gemeinnützigen Organisation, die Ziele von HateAid zusammen. Aus ihrer Beratungspraxis kann sie bestätigen, dass sich vermehrt Journalist:innen an HateAid wenden. „Die Gefahr wächst mit bestimmten Themen, über die sie schreiben. Dazu gehören hitzige Diskurse wie Feminismus, Klima, Migration, Nahostkonflikt und auch bestimmte politische Ereignisse. Auch Aspekte der Intersektionalität spielen oft eine Rolle: Ist die Person eine Frau? Hat sie einen internationalen Hintergrund? Ist sie queer? Solche Fragen erhöhen oft die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Angriffe“, berichtet Strieder.

Betroffenen bietet die NGO sowohl eine präventive Beratung als auch eine Akutberatung. In einzelnen Fällen unterstützt sie auch durch eine Prozesskostenfinanzierung. „Dann übernehmen wir die Kosten für eine anwaltliche Beratung und die Gerichtskosten. Etwaige Schmerzensgelder und Entschädigungen fließen in unseren Solidaritätsfonds zurück“, berichtet Judith Strieder.
Wie die Unterstützung dann praktisch abläuft, hängt stark vom Einzelfall ab. Oft geht die Beratung über ein „emotional stabilisierendes Erstgespräch“ hinaus und umfasst zudem Kommunikationsberatung, Sicherheitsberatung oder einen sogenannten Krisenplan. „Dabei entwirft man gedanklich vorab ein Worst Case-Szenario, um auf dieses gut vorbereitet zu sein, denn in akuten Krisen sind Menschen sonst oft sehr hilflos und ohnmächtig“, erklärt Beraterin Strieder.
Bei einer Kommunikationsberatung wird unter anderem gemeinsam überlegt, „wann es Sinn macht, auf Hasskommentare zu reagieren oder ein Statement zu verfassen“. Bei der Sicherheitsberatung wird geprüft, ob, wo und welche privaten Daten im Netz zu finden sind, die Betroffene auffindbar und angreifbar machen und wie sie gelöscht werden können
Falls eine Impressumspflicht besteht, können Betroffene sich anwaltlich beraten lassen, welche Alternativen zur Verfügung stehen. Die HateAid-Berater:innen prüfen auch mit Betroffenen, ob eine Melderegisterauskunftssperre eingerichtet werden kann und unterstützen den Antrag mit einem Empfehlungsschrieben.
Welches positive psychologische Kapital können Journalist:innen bei sich selbst aktivieren? „Abgrenzungsmechanismen sind wichtig. Man sollte sich klar machen, dass man nicht als Person angegriffen wird, sondern für das, wofür man steht. Journalist:innen sind ein Paradebeispiel dafür. Das klingt jetzt nach einem banalen Ratschlag, aber es hilft ungemein“, sagt Beraterin Strieder.
Helfen könne auch eine gute, professionelle Psychohygiene. Dazu gehört etwa, den Arbeitsplatz vom zuhause zu trennen, genug Pausen zu machen, stabilisierenden und kraftgebenden Aktivitäten nachzugehen. Diese Maßnahmen sind auch Teil des HateAid -Krisenplans.
HelpLine – Hilfe in jeder Krisenlage
Die HelpLine beim Netzwerk Recherche ist eine unabhängige, anonyme und kostenlose Telefonberatung für mental belastete Journalist:innen. Wo HateAid zielgenau in psychischen Belastungssituationen unterstützt, die durch digitale Angriffe ausgelösten wurden, stellt sich die HelpLine breiter auf. „Hohe Arbeitsbelastung, prekäre Beschäftigung, niedrige Honorare, Druck in der Redaktion, Bedrohungen auf Demonstrationen, grausame Bilder am Fotodesk“ werden auf der Site der NGO genannt.
„Wir kümmern uns um alles, was den Anrufenden auf dem Herzen brennt. Unsere Hauptaufgabe besteht vor allem darin, zunächst einmal sehr gut zuzuhören. Einen Leitfaden der Gesprächsführung gibt es aber auch bei uns“, sagt Malte Werner, Projektleiter bei der HelpLine.
Unter den Anrufenden sind mehr Freie als Festangestellte. Kolleg:innen aus den Mediengattungen Online und Print nehmen mehr als die Hälfte der Beratungsangebote in Anspruch. Personen aus anderen Bereiche, etwa aus Foto, Video, Audio, seien seltener vertreten, berichtet Werner.

Neben der telefonischen Beratung, die jede Woche für 12 Stunden angeboten und im Durchschnitt etwa eine Stunde lang in Anspruch genommen wird, absolvieren die HelpLine-Betrater:innen zahlreiche Auftritte bei Konferenzen, in Medienhäusern, bei Redaktionen und in Gesprächsrunden mit Führungskräften. „Damit kommen wir auf weit mehr Beratungszeit als bei der einen Stunde Telefonberatung pro Woche“, bilanziert Werner.
Gerade wird ein WhatsApp-Kanal eingerichtet, um Journalist:innen einen niedrigschwelligen Zugang anzubieten. „Denn wir dürfen nicht vergessen: Es ist sicher eine Herausforderung, sich selbst eine mentale Notlage zunächst einzugestehen, dann zum Telefonhörer zu greifen und anschließend einer komplett fremden Person sehr private Dinge zu erzählen. Eine kurze WhatsApp-Nachricht als erste Kontaktaufnahme funktioniert vielleicht für viele besser“, vermutet Projektleiter Werner.
Medienhäuser 1: Hilfsangebote bei der Funke Gruppe
Der eingangs geschilderte Übergriff auf den thüringischen Lokalreporter Peter Hagen hatte eine unmittelbare Wirkung. „Dieser Fall war der Auslöser unserer Aktivitäten in Richtung betriebliche psychologische Erstbetreuung. Damals wurde klar: Hey – da müssen wir etwas tun“, sagt Guido Burckert in einem Interview mit einer Berufsgenossenschaft. Er ist Head of Health, Safety & Fireprotection bei der Funke Mediengruppe, zu der Hagens Arbeitgeber, die Ostthüringer Zeitung, gehört.
Im Fall Hagen war es ein körperlicher Übergriff. In anderen Beispielen aus Burckerts Berufspraxis waren Kolleg:innen betroffen, die über eine Amokfahrt berichteten, zu Zeug:innen der Love-Parade-Katastrophe in Duisburg wurden oder bei einem Kindesmissbrauchsfall im Gerichtssaal saßen. Treffen kann es jede und jeden jederzeit.
„Das sind außergewöhnliche Situationen, die man erst einmal verarbeiten muss. Und das verarbeitet jeder anders. Weil all das im beruflichen Zusammenhang passiert, sind das auch klassische Arbeitsunfälle“, sagt Burckert.
Die Hilfe läuft deshalb auch über die Berufsgenossenschaft. Das ist, laut Guido Burckert, auch sinnvoll: „Falls Sie mal privat versucht haben, einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen, werden sie vielleicht festgestellt haben, dass das bis zu vier Wochen dauern kann. Bei einem berufsbedingten Vorfall ruft die Berufsgenossenschaft Sie innerhalb von 24 Stunden zurück und versucht, Ihnen zu helfen. Die haben die gesetzliche Verpflichtung dazu“, sagt der Sicherheitsexperte.
Anlaufstellen in der Not finden Funke-Mitarbeiter:innen im Funke-Intranet, auf der Seite für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Dort stehen die Kontaktdaten der Hanza, eines arbeitsmedizinischen Beratungszentrums in Hamburg, und der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Beide Beratungsfirmen können bei berufsbedingten, aber auch bei privaten Problemlagen in Anspruch genommen werden, anonym und kostenfrei. Allerdings nur zur Erstberatung, nicht zur längerfristigen Behandlung oder Therapie.
„Wir hatten bei diesen Organisationen in den letzten Jahren immer etwa 10 bis 15 in Anspruch genommene Beratungen pro Jahr. Die Kosten dafür werden von Funke getragen. Am Ende des Monats rechnen die beiden Organisationen mit uns die jeweils angefallenen Beratungszeiten ab – anonym, was die beratenen Kollegen angeht“, erklärt Burckert.
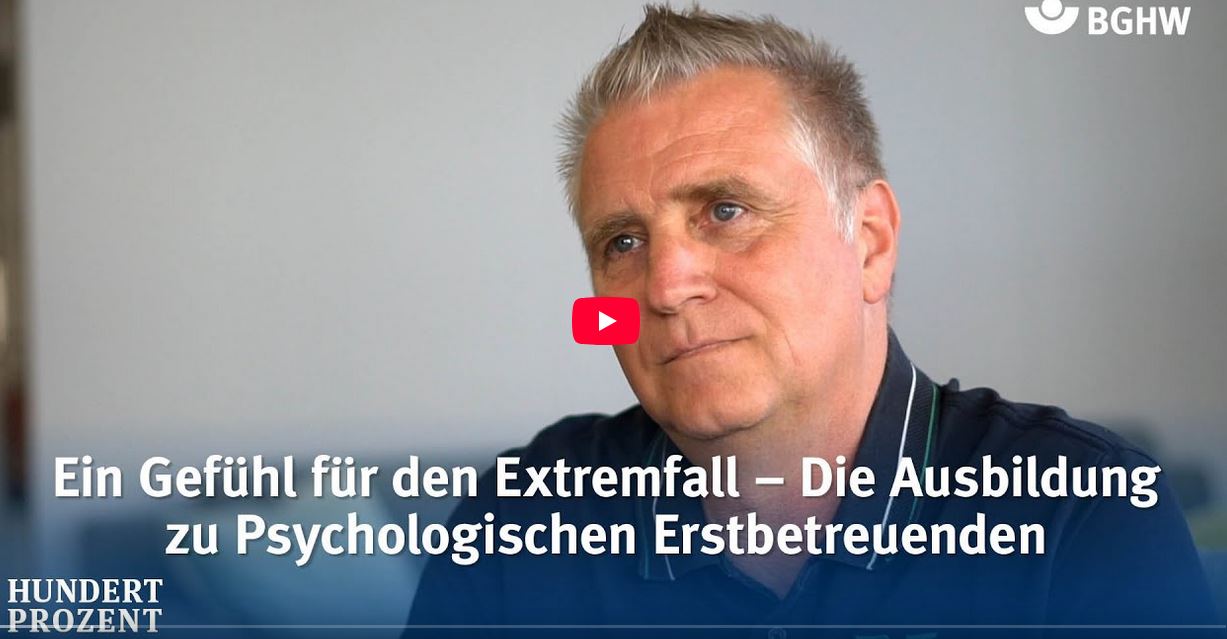
Eine weitere Unterstützungsstruktur sind bei Funke die sogenannten betrieblichen psychologischen Erstbetreuer (BPE). „Die haben wir zusammen mit der Berufsgenossenschaft ausgebildet. Sie bieten Kolleg:innen, die auf sie zukommen, Hilfestellung an. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir 46 Mitarbeiter:innen, oft aus der Redaktion, geschult und in Berlin 17. Die Kosten dafür hat die Berufsgenossenschaft übernommen“, sagt Burckert. Zur Ausbildung der PBE an zwei Schulungstagen gehören zum Beispiel das Erkennen und der Umgang mit Traumata, aber auch Maßnahmen zum Eigenschutz.
Medienhäuser 2: Hilfsangebote bei der Zeit-Verlagsgruppe
Bei der Zeit-Verlagsgruppe hat Frank Kohl-Boas, seit 2018 und noch kurze Zeit Leiter Personal und Recht, Unterstützungsangebote für Kolleg:innen in psychischen Notlagen organisiert. „Wir haben die bestehenden professionellen Angebote zusammengeführt und ergänzt: Dazu gehören etwa SmartRiskSolutions und das Dart Center for Journalism & Trauma. Wir machen diese Anlaufstellen intern bekannt und vermitteln als Personalverantwortliche anfragende Kolleg:innen an die Expert:innen weiter“, berichtet er.
Als Auslöser der Unterstützungsangebote bei der Zeit-Gruppe nennt Kohl-Boas unter anderem gesellschaftliche Entwicklungen wie die Corona-Pandemie, die in vielen Menschen Gefühle der Unsicherheit, Hilflosigkeit oder mangelnder Selbstwirksamkeit ausgelöst hätten. Daneben habe es aber auch ganz konkrete Anlässe gegeben, etwa als Kolleg:innen auf Demonstrationen oder AfD-Veranstaltungen angegangen worden waren oder psychisch belastet aus Krisengebieten zurückgekehrt seien. „Daher gehören solche Unterstützungsangebote bei uns auch zur Nachbereitung nach Einsätzen. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Belastungsszenarien sind sehr unterschiedlich und anlassbezogen auch fließend“, sagt Kohl-Boas.

Für Kolleg:innen in privaten Notlagen stellt die Zeit-Gruppe ein Employee Assistance Program (EAP) zur Verfügung. „Wir wissen, dass die Menschen die privaten Themen, die sie belasten, mit zur Arbeit bringen. In solchen Situationen helfen den Mitarbeitenden spezielle Beratungsunternehmen, die Unterstützung zu verschiedenen Themen anbieten. Bei uns ist das die Insite Interventions GmbH, es gibt aber auch etliche andere Anbieter. Wir haben dieses Angebot mit unseren Betriebsräten bereits 2018 angestoßen“, sagt Kohl-Boas.
Die Zeit-Gruppe rechnet die Beratungen mit den Firmen in Form einer Pauschale ab. So müssen sich die einzelnen Mitarbeitenden eine Beratung nicht genehmigen lassen und bleiben anonym. Der Betriebsrat und der Personalchef bekommen halbjährlich eine anonyme, aggregierte Auswertung, um prüfen zu können, wo es im beruflichen Umfeld Herausforderungen gibt, auf die das Unternehmen unter Umständen positiven Einfluss nehmen könnte. „Die Themen spielen sich aber zum ganz überwiegenden Teil im Privaten ab“, berichtet der Personalleiter der Zeit-Verlagsgruppe.
Auch er hat, wie andere Verlagspersonaler, psychologische Ersthelfer:innen ausbilden lassen. Bei der Zeit-Gruppe sind 12 Kolleg:innen qualifiziert worden. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Kurse gut besucht waren“, sagt Kohl-Boas.
Fazit
Die in der LMU-Studie festgestellten psychischen Belastungen der deutschen Journalist:innen sind real und allgegenwärtig. Die befragten Vertreter:innen von NGOs und Verlagshäusern bestätigen die Diagnose.
Auslöser solcher mentalen Notlagen sind oft alltägliche Ereignisse, etwa der Besuch einer Gerichtsverhandlung, eine Demobegleitung, anonyme Hatemails oder ein Streit mit dem Redaktionsleiter. Treffen kann es jede und jeden jeden Tag.
Die gute Nachricht ist, dass es inzwischen in der Branche, bei den Verbänden und in den Medienhäusern ein gestiegenes Problembewusstsein gibt. Und zahlreiche Hilfsangebote. Für freie Kolleg:innen bieten NGOs wie HateAid oder Helpline professionelle Hilfe an. Niemand muss in solch einer Situation allein bleiben.
Das Magazin Fachjournalist ist eine Publikation des Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV).
Unterstützungsangebote in Kürze:
- HateAid bietet Beratung, Unterstützung und praktische Hilfe für Journalist:innen, die von digitaler Gewalt oder Hass im Netz betroffen sind oder Zeug:innen von Online-Angriffen wurden.
- Die HelpLine von Netzwerk Recherche ist eine unabhängige, anonyme und kostenlose Telefonberatung für mental belastete Journalist:innen.
- Die Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt berät feste und freie Mitarbeitende aus bestimmten Brancheneinrichtungen der Kultur- und Medienbranche „unabhängig, überbetrieblich und unentgeltlich“. Betroffene, Zeug:innen und Arbeitgebende werden juristisch und psychologisch betreut.

