Wann fließen die KI-Erlöse?

Seit Jahren trainieren die großen IT-Konzerne ihre KI-Systeme (auch) mit journalistischen Inhalten. Lizenzgebühren zahlen sie dafür in der Regel keine. Die Autor:innen und Journalist:innen gehen leer aus. Doch es gibt erste Anzeichen dafür, dass die KI-Industrie damit beginnen muss, umzudenken, um die Urheber:innen an ihren Erlösen zu beteiligen. Hier folgen ein Überblick über die derzeitige Situation und Expert:innen-Stimmen zum aktuellen Geschehen.
Die gerne auch „Saure-Gurken-Zeit“ genannte nachrichtenarme Zeit fiel in der Medienbranche in diesem Sommer aus. Auf die Verlagswelt stürmten fast in Monatsabständen aufsehenerregende Nachrichten aus der Welt der KI ein: Im Mai startete die VG Wort ihre erste KI-Lizenz, „Perplexity will Verlage beteiligen, wenn Inhalte genutzt werden“, meldete Heise online im August und zdf.heute titelte im September: „KI-Firma will Autoren 1,5 Milliarden zahlen“.
Erlösbeteiligung – Entschädigung – KI-Lizenz: Zeigt das jahrelange Protestieren, Klagen und Prozessieren der Medienhäuser, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Berufsverbände und Gewerkschaften gegen die tägliche unentgeltliche Aneignung urheberrechtlich geschützter Werke für das KI-Training endlich Wirkung?
Oder sind die genannten Ereignisse, die scheinbar eine neue Ära der friedlichen Koexistenz („Wandel durch Handel“) zwischen KI und Journalismus einläuten, nur punktuelle Strohfeuer, die bald wieder erlöschen – oder ausgetreten werden? Und wie würden die Journalist:innen selbst von diesen Entwicklungen profitieren?
Entschädigung der Urheber via Gerichtsurteil: der „Anthropic-Fall“
1,5 Milliarden Dollar für die Urheber:innen – 3.000 Dollar pro Buch. Diesen Betrag offerierte der KI-Anbieter Anthropic Autor:innen, deren Werke er zum Training seiner KI Claude hochgeladen hatte. Für viele Contentproduzent:innen klang das nach einem Durchbruch im Kampf um eine faire Entschädigung durch die KI-Industrie.
Allerdings hat der zuständige Bundesrichter Alsup aus San Francisco den Vergleich zunächst bis zu einer erneuten Prüfung aufgeschoben. Und er hält auch nicht das Training der Claude-KI mit urheberrechtlich geschützten Werken für problematisch, sondern allein die Tatsache, dass dazu Raubkopien der geschützten Werke genutzt wurden. Handelt es sich bei dem Anthropic-Vergleich also eher um eine Maßnahme zum Schutz der KI-Firmen als um eine Verteidigung der Rechte der Autor:innen?
„Illegal beschaffte Bücher fürs Training zu benutzen, ist ein No-Go. Deswegen ist Anthropic den Weg des Vergleichs gegangen, statt zu eskalieren und möglicherweise am Ende noch mehr zahlen zu müssen. Das ist aus meiner Sicht aber kein Hinweis darauf, dass sich die Fair-Use-Debatte jetzt zugunsten der Inhalte-Ersteller entwickelt“, ordnet Matthias Bastian den Fall ein. Er ist Journalist und Publisher der Plattform The Decoder, die sich bevorzugt mit KI-Themen beschäftigt.
Zur Erinnerung: Fair Use begründet im US-Recht die Möglichkeit, geschützte Inhalte zur „öffentlichen Bildung“ und zur „Anregung geistiger Produktionen“ zu nutzen, ohne sich zuvor die Einwilligung der Urheber:innen eingeholt zu haben. Die KI-Industrie beruft sich beim Thema KI-Training permanent auf diesen Passus.

Matthias Bastian ist skeptisch, ob der Fall Anthropic für eine Trendwende steht. Allerdings müsse man sich fragen, ob nicht bereits das Scraping, das „Abschürfen“ der Inhalte von den Webseiten, eine Form der Raubkopie darstellt. „Ich denke, dass solche Themen aufkommen werden, aber das ist auch ein bisschen Kaffeesatzleserei“, sagt der KI-Spezialist.
Vielleicht werden die großen KI-Unternehmen jetzt zunächst ihre Datenbestände bereinigen und Raubkopien aussortieren. Bastian vermutet auch, dass möglicherweise bald eher synthetische Daten statt urheberrechtlich geschützter Inhalte für das KI-Training herangezogen werden. „Ich denke aber nicht, dass bei diesen Unternehmen irgendeine Form von Fairnessverständnis herrscht. Da wird nur das gemacht, was rechtlich unbedingt erforderlich ist“, schätzt KI-Markt-Kenner Bastian die Lage ein.
Sind individuelle Klagen möglich?
Mit dem Anthropic-Vergleich steht die Frage im Raum, ob sich Urheber:innen individuell gerichtlich gegen die Nutzung ihrer Werke für das KI-Training wehren können.
Der Journalist Henry Steinhau weist in diesem Zusammenhang auf einen interessanten Sonderfall hin. Steinhau ist beim iRights.Lab, einer unabhängigen Berliner Denkfabrik, die sich mit der Gestaltung des digitalen Wandels beschäftigt, für Forschung und Projekte verantwortlich. Er erinnert an den „Laion-Fall“ aus dem vergangenen Jahr, einem der ersten deutschen KI-Copyright-Gerichtsverfahren. Dabei hatte ein Hamburger Fotograf gegen die Übernahme seiner Fotos in eine wissenschaftliche Datenbank geklagt, die auch zum Training von KI benutzt wird. „Im Laion-Fall gestand das Gericht zwar dem KI-Anbieter den Zugriff auf die Fotos als legal zu, wies aber zugleich auf die Option des sogenannten Nutzungsvorbehalts durch Urheber*innen hin“, sagt Steinhau.
Wichtig ist dabei, dass auch in „natürlicher Sprache“ auf der eigenen Website formulierte Nutzungsvorbehalte gegen das „Abgrasen“ der Inhalte durch KI-Bots als maschinenlesbar im Sinne der rechtlichen Vorgabe gelten könnten. Ob die KI-Unternehmen solche ausformulierten Nutzungsvorbehalte akzeptieren, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt aber durchaus individuelle Handlungsoptionen gegen die Enteignung der eigenen Werke fürs KI-Training.
Kooperationsverträge zwischen Verlagen und KI-Anbietern
Aufsehen erregte im August die Ankündigung der KI-Firma Perplexity, Verlage an den Abo-Erlösen ihrer KI-Suchmaschine Comet Plus zu beteiligen. Dabei soll an Verlage, die unter anderem über die Comet-Suche von ihnen selbst kuratierte Nachrichten zugänglich machen, 80 Prozent der Comet Abo-Einnahmen ausgeschüttet werden. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass Perplexity zuvor wiederholt mit den Klagen von Medienhäusern konfrontiert worden war, ihre Inhalte unerlaubt übernommen zu haben. Heise online berichtete darüber.
In Deutschland kooperieren unter anderem der Spiegel und die RTL Gruppe mit dem Perplexity-Partnerprogramm. Die dpa kooperiert mit dem KI-Unternehmen you.com, Axel Springer arbeitet mit Open AI und Microsoft zusammen und der Burda Verlag mit Black Forest Labs. Auch in den USA gibt es bereits zahlreiche KI-Verlags-Kooperationen.
Henry Steinhau vom iRights.Lab ordnet diese Joint Ventures so ein: „Letzten Endes läuft das immer auf eine Kompensation der von der KI genutzten Verlagsinhalte hinaus. Entweder als einmaliges Buy-out oder als laufende Provisionsregelung, wie im Fall von Perplexity“, sagt Steinhau.
Matthias Bastian von The Decoder misstraut den Kooperationsverhältnissen und hält sie für strategische Manöver. Es würden zunächst große Verlage eingekauft, um ein Ökosystem aufzubauen. Kleinere Verlage müssten dann mitziehen, um überhaupt noch auf den Plattformen vorzukommen. „Das ist das Playbook von Silicon Valley. Das hat Google so gemacht für die normale Suche und das werden sie bei der KI-Suche wieder so machen“, ist sich Bastian sicher. Das mögliche Szenario habe der Medientheoretiker Jeff Jarvis in einem Beitrag für The Decoder beschrieben.
Kommen die Erlöse aus den Verlags-KI-Kooperationen bei den Journalist:innen an?
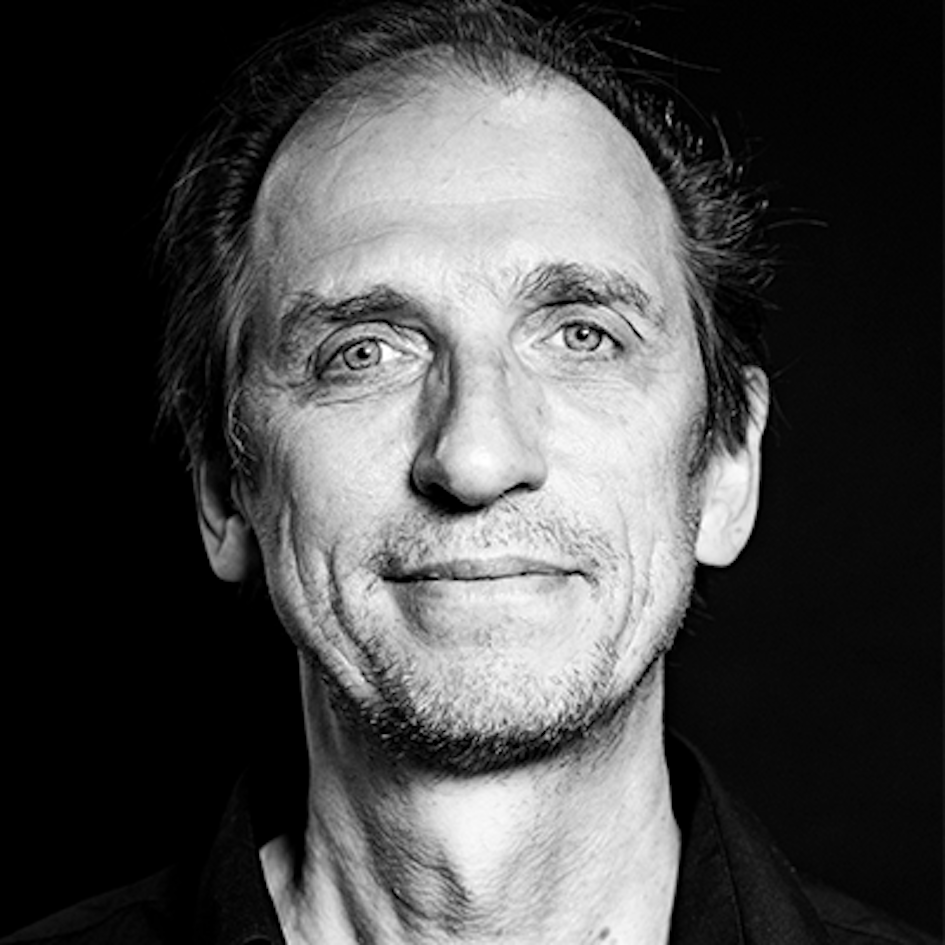
In einer Kurzstudie für die Hans Böckler Stiftung haben sich Steinhau und seine Kolleg:innen vom iRights.Lab mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Journalismus aus der Perspektive der Beschäftigten auseinandergesetzt. „Man weiß noch nicht so genau wie diese zusätzlichen Verlagseinnahmen an die eigentlichen Urheber, die Journalisten, durchgereicht werden. Vielleicht bekommen die ja auch bestimmte Klauseln in ihre Verträge, die sagen, dass die Nutzungsart KI automatisch mit dem Gehalt oder dem Honorar abgegolten ist“, vermutet Henry Steinhau vom Berliner Thinktank.
Für erwartbar hält er, dass es bald auch pauschale Lizenzzahlungen von KI-Firmen an die Verwertungsgesellschaften geben wird. „Dann bekäme ich als Journalist von der VG Wort auch eine jährliche Ausschüttung für die KI-Nutzung meiner Texte, vergleichbar den Ausschüttungen, die ich bereits jetzt bekomme, weil meine Texte als Privatkopien oder über Pressespiegel weiterverbreitet werden“, sagt Henry Steinhau.
VG Wort mit einer ersten KI-Lizenz für Unternehmen und Behörden
Einen ersten Testballon in die von Steinhau beschriebene Richtung hat die VG Wort mit ihrer neuen KI-Lizenz gestartet. In der Lizenz „steckt“ vorwiegend Fach- und Wissenschaftsliteratur. Tages- und Publikumspresse sind bisher nicht mit dabei.
„Wir wollten als VG Wort, nachdem wir das intern sehr intensiv und lange diskutiert hatten, mit einem begrenzten Lizenzangebot an den Start gehen. Grundsätzlich gilt, dass die VG Wort bei derartigen Lizenzmodellen nur tätig werden kann, wenn ihr die Rechte einvernehmlich von Urhebern und Verlagen eingeräumt werden“, sagt Robert Staats, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der VG Wort. Die seit Mai angebotene KI-Lizenz richtet sich bisher ausschließlich an Unternehmen und Behörden und wird mit der bereits seit vielen Jahren existierenden digitalen Unternehmenslizenz in einem Bündel vertrieben. Sie erlaubt nur unternehmensinterne Nutzungen.
Wie verhindert die VG Wort, dass die Lizenz von den Unternehmen auch extern eingesetzt wird, etwa um neue KI-Produkte für den Markt und die Consumer zu trainieren, entwickeln und zu vertreiben? „Wir können das nicht innerhalb der Unternehmen überwachen. Aber die Nutzungsrechte werden auf der Grundlage von Verträgen eingeräumt, in denen die Lizenzbedingungen klar geregelt sind. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Unternehmen durchaus daran interessiert sind, sich urheberrechtskonform zu verhalten; das ist ja ein wichtiger Grund, warum sie die Lizenzen überhaupt erwerben. Missbrauchsfälle sind uns bisher nicht bekannt geworden“, sagt Vorstand Staats.

Seit Mai hat die VG Wort etwa 150 Lizenzen an – zumeist große – Unternehmen verkauft. Kunden sind bisher vor allem Unternehmen aus der Branchen Life Science, Pharmazie, Gesundheitswesen und Chemie. Andere Interessenten kommen aus der Beratungs- und der Finanzbranche.
Und wie verfährt die VG Wort, wenn Fachautor:innen nicht mit einer solchen KI-Verwertung ihrer Werke einverstanden sind? „Werke solcher Autorinnen und Autoren werden in Zusammenarbeit mit Rights Direct nicht lizenziert. Es besteht eine Datenbank, in der nur Inhalte, die lizenziert werden dürfen, verzeichnet sind. Es gibt also eine Widerspruchsmöglichkeit und die wird beachtet“, bekräftigt Robert Staats.
Wann können Autor:innen mit Ausschüttungen aus der KI-Lizenz rechnen?
Zurzeit hat die VG Wort für die KI-Lizenz noch keine explizite Regelung in ihrem Verteilungsplan. Die wird in der Mitgliederversammlung beschlossen.
Im Bereich der bisherigen Unternehmenslizenz sieht der Verteilungsplan eine pauschale Verteilung der Einnahmen über andere Ausschüttungssparten vor, etwa im Bereich der Verteilung für Vervielfältigungen von wissenschaftlichen Werken und Fachpublikationen.
Grundsätzlich begrüßt Staats Lizenzierungen von KI-Nutzungen geschützter Werke. Diese machten deutlich, dass auch derartige Nutzungen einer vertraglichen Erlaubnis der Rechtsinhaber bedürfen und sie ermöglichten zudem Vergütungen.
Ob Lizenzen individuell von Urhebern oder Verlagen vergeben würden, oder ob kollektive Lizenzangebote über Verwertungsgesellschaften sinnvoll seien, müsse genau geprüft werden.
Fazit
Die Zeiten, in denen sich die großen Tech-Unternehmen – fraglos und scheinbar unbeeindruckt – auf die Formeln „Fair Use“ und „Text and Data Mining“ zurückziehen konnten, gehen möglicherweise langsam zu Ende. Klare Gerichtsurteile zugunsten der Urheber:innen fehlen aber noch.
Die Lizenzvereinbarungen zwischen KI- und Content-Branche zeigen: Auch die Tech-Industrie beginnt zu verstehen, dass die Medien, die sie mit Inhalt füttern (manchmal mit schwer Verdaulichem – Raubkopien), bald ein existenzielles Problem bekommen und dass deren Beteiligung grundlegend für den eigenen Erfolg ist.
Es bleibt zu hoffen, dass dafür nachhaltige und faire Modelle entwickelt werden – nicht nur kurzfristige taktische Manöver. Das gilt auch für die Verlage, die ihre Produzierenden gerecht beteiligen müssen. KI kann vieles im Journalismus, aber auch sehr vieles nicht. Bleibt zu hoffen, dass hier nicht „Gier blind macht“.
Die KI-Lizenzen der Verwertungsgesellschaften sind eine weitere mögliche Brücke, über die die Urheber:innen zu ihrem Recht und zu einer fairen Erlösbeteiligung am KI-Geschäft kommen könnten.

